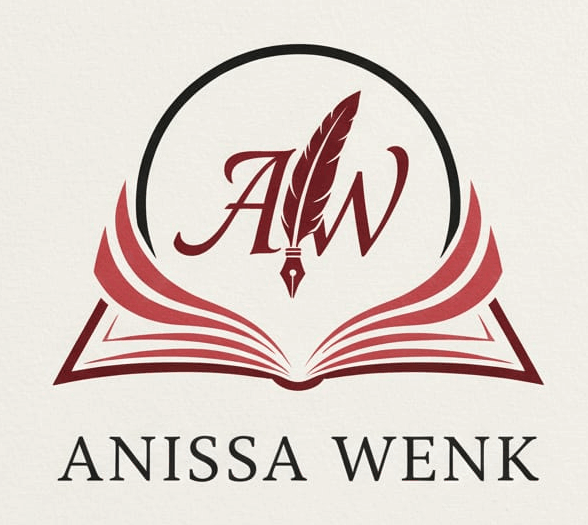Meine Kurzgeschichten
Es bleibt spannend. Bald kommen neue Geschichten dazu.
Auf den Titel klicken ↓
Mit Sahne der Sonne hinterher
Diese Geschichte ist wahr, auch wenn sie ein wenig phantastisch klingt.
Ich stehe mit meinem Taxi auf St. Pauli, alleine vor einem namhaften, guten Hotel. Der Tag und somit meine Schicht neigt sich langsam dem Ende. Einen Fahrgast hätte ich jedoch noch gerne.
Hinter mir fährt eine weitere Taxe auf den Posten. Die Tür geht auf und eine Frau mit grauen, kurzen Haaren, ich schätze sie auf Anfang sechzig, steigt aus. Sie trägt eine große Umhängetasche über der Schulter. Für mich ist die Situation eindeutig, ein Kollege setzt einen Fahrgast vor dem Hotel ab. Die Dame winkt zum Abschied. Ich widme mich wieder meinem Buch, denn ich überbrücke die Wartezeiten gerne mit Lesen.
Auf einmal klopft es auf der Beifahrerseite an die Scheibe. Ich blicke auf. Vor meinem Auto steht die grauhaarige Dame, die vor nicht einmal einer Minute aus dem anderen Taxi gestiegen war.
Sie lächelt, und ich gehe davon aus, dass sie eine Frage hat. Ich lasse die Scheibe herunter und sage freundlich: „Kann ich Ihnen helfen?“
„Sind Sie frei?“
Damit habe ich nun gar nicht gerechnet. „Äh… Ja, bin ich.“
Ich mache Anstalten aus dem Wagen zu steigen, um der Dame, wie ich es immer tue, behilflich zu sein, doch sie winkt nur ab und sagt: „Bitte, bleiben Sie sitzen!“
Gut, dann bleibe ich da, wo ich bin.
Sie steigt ein, fährt den Sitz ganz zurück, positioniert ihre Tasche zwischen ihren Beinen, schnallt sich an und blickt zufrieden lächelnd aus der Frontscheibe, sagt jedoch kein weiteres Wort.
Mich hat die Neugierde gepackt. „Hat mein Kollege Sie versehentlich vor dem falschen Hotel abgesetzt?“
Sie wendet sich mir zu. Meine Vermutung mit dem Alter würde ich an dieser Stelle wiederholen, ihre Ausstrahlung ist frisch und vital. Sie lächelt und dieses Lächeln erhellt das ganze Gesicht. Sie ist sehr schlank, ohne dabei dürr zu wirken. Die Haut ist wettergegerbt, aber dennoch nicht ledrig. Am auffallendsten sind die ganz klaren, hellen Augen, in welchen sich ihr Lächeln widerspiegelt.
Sie schaut mir direkt ins Gesicht und antwortet: „Ach, weißt du, Schätzchen, ich war der Meinung, meine Arbeit da ist getan, und ich bräuchte einen neuen Gesprächspartner.“
Das Fahrgäste nach einer Weile immer vertraulicher werden, ist nichts Neues, aber der Umschwung von „Sie“ auf „du“ und „Schätzchen“ verblüffte mich nun doch. Ganz der Profi, lächele ich diese kurze Unsicherheit weg und versuche mich auf meinen neuen Gast einzustellen. Jeder Mensch ist anders und als Taxifahrer hat man meistens nur einen kurzen Moment, um seinen Fahrgast einzuschätzen. Es ist alles nur Übung. Meine Einschätzung: Nett, harmlos, etwas eigentümlich und möchte sich unterhalten. Gut, das kann ich auch.
Ich lächele, schalte den Plauderton an und gehe über zur Routine: „Wohin darf ich Sie denn fahren?“
„Fahr doch erstmal los.“
Ich starte den Wagen und rolle vom Posten. Sie gibt mir nur ein Zeichen mit der Hand, ich solle geradeaus fahren. Ich folge.
Wenn ich etwas nicht leiden kann, dann ist es, kein Ziel zu haben. Ich überlege, wie ich die Information erhalte, ohne zu sehr zu drängeln. Wir kommen an eine große Kreuzung, die Ampel ist rot. Ich räuspere mich und setze vorsichtig an: „Es wäre sehr hilfreich für mich, wenn ich ungefähr die grobe Richtung wüsste.“
„Wir müssen der Sonne hinterher.“
„Wie bitte?“ Ich muss mich verhört haben.
„Wir müssen der Sonne hinterher.“ Bekomme ich die gleiche Ansage.
‚Macht sie Witze? Vielleicht will sie mich ein wenig auf den Arm nehmen?‘
„Das wird auf Dauer schwierig, denn die Sonne geht gleich unter“, erwidere ich scherzhaft.
„Ich weiß. Wir müssen der Sonne hinterher, sie einfangen, stellen und ihr dann den Rücken zukehren, dann geht sie wieder auf.“ Ich ahne sofort, dass ist ihr voller Ernst.
Taxifahrer haben drei unumstößliche Pflichten, neben der Tarif- und Betriebspflicht gibt es noch die Beförderungspflicht. Grundsätzlich muss jedermann im Pflichtfahrgebiet befördert werden. Außer er stellt eine Gefahr für sich oder andere dar, das gilt natürlich auch für mich und mein Fahrzeug. Doch das Einzige was für mich gerade stark gefährdet scheint, sind meine Nerven.
Meine Sonnenanbeterin sucht meinen Blick. Ich gucke sie an und sie lächelt. Ich denke: ‚Nun gut, immerhin eine nette Verrückte.‘ Ich nicke und füge mich in mein Schicksal.
Ihr Lächeln wird daraufhin noch breiter. Sie guckt wieder aus der Frontscheibe und zeigt tatsächlich in Richtung Sonne. So fahren wir gemeinsam nach Westen. Und wer weiß, wohin noch.
Wir fangen an uns zu unterhalten. Belanglose Sachen, nichts Besonderes, über Bücher, Filme und Essen. Um die Themen Wetter und Politik machen wir einen großen Bogen.
Gerade als ich anfange mir um unser Fahrziel und den Geisteszustand meiner Kundin keine Sorgen mehr zu machen, fängt sie an, sich durch die Hose ihre Schienbeine zu kratzen.
„Ach, Schätzchen, die Haut an den Schienbeinen ist so dünn und trocken. Nach einer Weile fangen sie bei mir immer an zu jucken.“ Sie kratzt weiter.
„Ja, ich verstehe, was Sie meinen, da sind auch so gut wie keine Fettzellen drunter.“ Ich finde meine Antwort nicht sonderlich originell, aber ich habe das Bedürfnis, das Gespräch am Leben zu halten.
„Richtig“, antwortet sie kurz und fängt an in ihrer Tasche zwischen ihren Beinen zu wühlen. Halb mit dem Kopf in der Tasche murmelt sie: „Es gibt auch nur eine Sache, die wirklich bei trockener, juckender Haut hilft.“
„Das wäre?“
„Sahne!“
‚Warum muss ich bloß immer so neugierig sein? Ich muss doch nicht alles wissen. Nun ist es zu spät.‘
Ich hole tief Luft und wiederhole: „Sahne?“
„Genau.“ Mit diesem Wort taucht meine Sonnenanbeterin freudestrahlend aus dem Fußraum auf und hält tatsächlich eine kleine Plastikflasche Schlagsahne in der Hand. Eine handelsübliche Sorte von einem uns bekannten Hersteller, der uns sagt, er liebe das Land.
Sie klemmt die Flasche zwischen ihre Beine und krempelt ihre Hose hoch. Mein Blick wandert unablässig zwischen ihren nackten Beinen und der Fahrbahn hin und her. Dann öffnet sie den Verschluss, kippt sich die weiße Flüssigkeit auf die Hand und schmiert sich tatsächlich hier in meinem Auto ihre Beine mit Sahne ein. Ich bin sprachlos. Das Einzige, was mir jetzt nur noch durch den Kopf geht, ist: ‚Wehe du kleckerst!‘
Ich atme einmal tief durch und beschließe, mir das Elend nicht weiter anzusehen. Ich konzentriere mich lieber auf den Verkehr.
Das klassische Geräusch eines Schraubverschlusses signalisiert mir, sie ist fertig. Vorsichtig schiele ich zum Beifahrersitze und erwarte im Stillen eine kleine Sauerei. Doch, oh Wunder, es ist alles sauber. Die Hosenbeine sind noch oben, wahrscheinlich ist die Sahne noch nicht eingezogen.
Plötzlich klopft sie leicht auf meinen rechten Unterarm und sagt: „Schätzchen, sei so lieb und fahr hier bitte auf die Autobahn.“
‚Auf die Autobahn?! Ach, du liebe Sch… Das ist nicht gut.‘
Doch was soll ich machen, Kunde ist König, und ich tue wie mir geheißen. Ich fahre auf die A7 in Richtung Hannover.
Im Elbtunnel gucke ich auf mein Taxameter. Es sind bereits über zwanzig Euro angefallen.
Langsam drängt sich mir die, wie ich finde, berechtigte Frage auf: ‚Hat Frau Sonnenanbeterin neben ihrem Verstand vielleicht auch ihre Geldbörse verloren?‘
Ich beschließe, der Frage auf den Grund zu gehen, denn es wäre mehr als übel, wenn wir in Hannover ankämen und erst dort feststellen würden, dass es vielleicht eine nette Fahrt war, aber mir nicht mehr als einen feuchten Händedruck bringt.
‚Okay, wie erfahre ich auf diplomatische Art und Weise etwas über die Liquidität meines Fahrgastes?‘ Ich hasse solche Gespräche.
„Äh, darf ich erwähnen, dass die Fahrt ganz schön teuer werden kann?“ Ich möchte gar nicht behaupten, dass das gerade wahnsinnig eloquent war, eher subtil, aber jetzt ist es raus. Aufmerksam versuche ich die Reaktion meiner Sitznachbarin zu studieren. Doch sie fragt nur: „Was kostet die Fahrt denn bis jetzt?“
„Einundzwanzig Euro achtzig.“
Sie schmunzelt und fragt mich: „Ist das teuer für dich?“
Ich bin verunsichert, da ich nicht erahnen kann, welche Richtung dieses Frage-Antwort-Spiel einschlagen wird. Doch mit der Wahrheit kommt man immer noch am weitesten, so antworte ich kurz und knapp: „Ja.“
Und wieder trifft mich ihr unergründlicher, lächelnder Blick während sie sagt: „Glaube mir, Schätzchen, das ist gar nichts.“
‚Okay, ich bin mehrere Meter tief unter einem Fluss in einem Autobahntunnel mit einer alten Frau, die eindeutig nicht nur verrückt, sondern auch pleite ist. Es wird irgendwie nicht besser.‘
„Die nächste Abfahrt fahre bitte ab.“
Wir kommen aus dem Tunnel und fahren Waltershof ab. Erleichterung macht sich bei mir breit. So lange wir Hamburg nicht verlassen, sind wir auf mir bekannten Terrain, und ich habe die Sicherheit, dass das Ganze nicht in einem wirtschaftlichen Desaster endet. Ich rechne nicht damit, dass sie mir schaden könnte, aber ich rechne definitiv nicht mehr damit, ich könne für diese Fahrt geldlich entlohnt werden. Genau diese Einschätzung der Lage sorgt dafür, dass ich mich entspanne, und beschließe, mich überraschen zu lassen, wie und wo diese Fahrt enden wird.
Der Himmel färbt sich langsam orange. Die Sonne selbst ist nur noch als schmale Sichel zu erkennen.
„Wo soll ich langfahren?“
„Fahre einfach geradeaus. Ich gebe dir ein Zeichen, wenn ich möchte, dass du abbiegst.“
„Dann halte ich es wie in der Fahrschule: Wenn nichts gesagt wird, dann weiter geradeaus.“
Sie lacht und meint: „So ist es recht, Schätzchen.“
An das Wort „Schätzchen“ habe ich mich irgendwie gewöhnt, und irgendwie ist es aus ihrem Mund richtig nett. Es vermittelt mir das Gefühl von Vertrautheit. Als wäre sie die nette alte Dame aus der Nachbarschaft, die man schon ewig kennt.
Tatsächlich bekomme ich diverse Anweisungen, wo ich langfahren soll. Ihre Handzeichen wirken beiläufig, doch bin ich fast sicher, dass sie genau weiß, wohin sie möchte, sie kann es nur nicht benennen.
Wieder fängt sie an, in ihrer großen Tasche zu wühlen. Ich erwarte, dass sie erneut nach der Sahne sucht, stattdessen kommen ein Tuch und eine Orange zum Vorschein. Das Tuch wird fein säuberlich auf ihrem Schoß ausgebreitet, dann sehe ich nur noch aus dem Augenwinkel, wie sie ihren Daumen in die feste Schale drückt. Sofort macht sich der frische Geruch, der Zitrusfrüchten so eigen ist, in der kleinen Fahrerkabine breit. Die Frucht ist so reif, dass ihr der helle Saft über die Hände läuft und auf ihren Schoß tropft. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen.
Als sie mit dem Schälen fertig ist, bricht sie das Fruchtfleisch auf, was nicht weniger saftig ist und hält mir einen Schnitzer entgegen. „Möchtest du auch ein Stück?“
Ihre Hand ist nass und klebrig vom Saft und von der Sahne, wie ich mich nur zu gut erinnere. Und wer weiß, was sie sonst so vorher noch mit dieser Hand gemacht hat.
Ich versuche es daher mit einem höflichen: „Nein, danke.“
„Wieso denn nicht? Sie ist ganz süß und sehr gesund!“
‚Denk nach! Wie kommst du aus dieser Nummer jetzt am einfachsten raus? Mein Hirn arbeitet auf Hochtouren. Wie reagieren geistig gestörte Menschen, wenn sie sich beleidigt fühlen?‘
„Äh,… Ich habe eine Allergie gegen Zitrusfrüchte“, stammle ich vor mich hin. Jetzt ist es raus, mal gucken, was kommt.
Frau Ich-habe-nicht-mehr-alle-Latten-am-Zaun mustert mich kurz, sagt dann aber: „Ach, das tut mir leid, dann eben nicht.“ Und fängt an, ihre Orange zu genießen. Auch dieses Mal alles, ohne den Wagen von innen einzusauen.
Plötzlich ruft sie: „Bitte, fahre hier rechts ran!“ Wir sind mitten im Nirgendwo, es ist nicht schwer sofort zu halten.
„Ich möchte hier kurz aussteigen, ist das in Ordnung für dich, Schätzchen?“
„Ja, ist kein Problem.“
Sie öffnet die Autotür und steigt aus. Die Tasche lässt sie im Fußraum stehen, damit ist mir klar, sie plant, auch wieder einzusteigen und nicht einfach wegzulaufen. Ich ziehe den Schlüssel ab, nehme mein Handy an mich und steige ebenfalls aus.
Wir stehen vor einer riesengroßen Fläche Brachland bzw. zukünftiges Bauland. In unserem Rücken befindet sich nur Industrie. Die Luft ist kühl und ganz klar. Der Himmel zeigt sich in einem tiefen Orangeton. ‚Morgen gibt es bestimmt schönes Wetter.‘
Ich trete zu der Dame. Sie steht da, am Rand von diesem leeren Fleckchen Erde, und das ganze Gesicht strahlt. ‚Was sieht sie, was ich nicht sehe?‘ Ich folge ihrem Blick. Doch da ist nichts. Hier und da wuchert etwas Unkraut und Gras. Und ganz in der Ferne ist der Turm einer kleinen Kirche zu erkennen. Mehr nicht. Doch sie lässt ihren Blick schweifen, als würde sie ganz viel wiedererkennen.
Langsam schwindet das Licht. Ich kann nicht sagen, wie lange wir hier schon stehen. Es ist ganz still und friedlich. Wieder gucke ich sie an. So muss jemand aussehen, der seinen Frieden findet. Ich kann nicht anders und frage sie: „Und? Haben wir die Sonne gestellt?“
„Ja, haben wir“, antwortet sie mir. Und wie ich sie so ansehe, fange ich an sie zu verstehen, denn bei diesen Worten ging bei ihr im Gesicht, die Sonne wieder auf.
Und dann fügt sie hinzu: „Das wird hier alles Weltkulturerbe!“ Dabei schwingt sie ihren Arm im großen Bogen, um auch alles von diesem kahlen Stück Land mit einzubeziehen.
‚Doch einen Sprung in der Schüssel.‘ Ich schmunzle still in mich hinein. Wenn da gerade etwas wie ein Zauber war, dann ist er jetzt verflogen.
Sie holt nochmal tief Luft, schließt kurz die Augen und sagt: „So, wir können wieder fahren.“ Kaum gesagt, sitzt sie auch schon wieder im Auto. Ich folge ihrem Beispiel und wir fahren los.
Genauso zielsicher wie sie mich hin gelotst hat, führt sie mich auch zurück. Wir fahren über die Köhlbrandbrücke in die Hafen City.
„Weißt du was, ich möchte mir gerne etwas Gutes tun. Ein bisschen Wellness wäre jetzt schön. Fahre mich bitte in die Innenstadt.“
Zum ersten Mal seit Beginn dieser Fahrt, habe ich ein Ziel vor Augen. Endlich kann ich selbst einen Weg einschlagen.
„Ach, warte mal, Schätzchen, fahre mich doch bitte gleich zum Hotel, die haben da auch einen schönen Spa-Bereich.“ Sie nennt mir den Namen, es ist aber nicht das, vor dem unsere Fahrt begann. Ich wundere mich heute über nichts mehr.
Wir fahren beim Hotel vor, und es kommt der Moment, wo ich mich die ganze Zeit gefragt habe, wie er wohl aussehen mag. Steigt sie aus und rennt weg? Steigt sie aus, erzählt mir noch eine drollige Geschichte und macht dann einen Schuh?
Ich stelle den Motor ab, lehne mich zurück und warte ab, was nun passiert.
Die Frau verschwindet wieder halbwegs in ihrer großen Tasche. Zum ersten Mal wird mir bewusst, dass wir vor einem Hotel stehen, sie aber gar kein Koffer bei sich hat. Es muss wohl alles in dieser Tasche sein. Sie taucht auf und hält eine Parfumflasche in der Hand, welche sie auch gleich benutzt. Eine Wolke von „4812“ oder was auch immer hüllt uns ein. Der Flacon verschwindet wieder, es soll zum Glück kein Tauschgeschäft werden. Sie wühlt weiter, sie sucht etwas.
‚Bitte lass es ein Portemonnaie sein!‘
Sie taucht auf und hält einen Briefumschlag in der Hand. Auf ihm ist klar und deutlich das Logo einer ganz bekannten Bank zu erkennen. Sie öffnet ihn, und mir stockt der Atem. Er ist prall gefüllt mit Geldscheinen, hauptsächlich großen.
„Wieviel macht das?“
Ich nenne ihr den Preis, den das Taxameter anzeigt. Sie entnimmt dem Umschlag die Scheine entsprechend, drückt sie mir in die Hand, lächelt und sagt: „Stimmt so.“
„Vielen Dank.“ Ich bin sprachlos. Es gibt sogar Trinkgeld.
Auf einmal fragt sie mich: „Was denkst du, mache ich beruflich?
Ich zucke nur mit den Schultern und sage: „Ich habe keine Ahnung.“
„Ich bin Putzfrau.“
„Ach, Putzfrau! Meine Mutter war früher auch als Putzfrau tätig. Als Teenager habe ich ihr häufig dabei geholfen.“
Und da ist es wieder, dieses unergründliche Lächeln. Sie streichelt mir kurz über die Wange und sagt: „Nein, so eine Putzfrau bin ich nicht.“ Dann steigt sie aus und verschwindet im Hotel.
Ich starte den Motor und mache mich auf den Heimweg.
Auf der Fahrt habe ich das unbestimmte Gefühl, dass irgendetwas in mir nachhallt, aber ich kann nicht greifen, was. Ich bin da, aber auch irgendwie nicht. Als ob ich neben mir stünde.
Doch eines ist mir ganz klar, diese Fahrt werde ich nie vergessen.
Willkommen in der Servicewüste
Es ist Feierabend, und ich beschließe einem namenhaften Geschäft, welches für Betten, Möbel und vieles mehr bekannt ist, einen Besuch abzustatten. Manche Dinge schiebt man gerne auf, besonders wenn sie nicht Spaß bringen, lecker schmecken oder spannend aussehen. Ich bin guter Dinge und fest der Annahme, dass ich dort für mein Vorhaben an der richtigen Adresse bin und ich es schnell hinter mich bringen kann. Schließlich sind sie laut ihres Werbeversprechens ein Fachgeschäft mit großer Auswahl und fairen Preisen.
Ich stürme also in den Laden und werde ad hoc entschleunigt. Ein Mitarbeiter steht hinter dem Kassentresen, er sieht kurz von einem Blatt Papier zu mir auf, registriert mich und lässt seinen Blick wieder sinken. Eine Kollegin von ihm schlendert mit den Armen hinter dem Rücken durch den Gang und schaut aus dem Schaufenster. Es war sofort klar, hier ticken die Uhren anders. Da der junge Mann weiterhin den Anschein erweckt, er würde schwer beschäftigt sein, beschließe ich die junge Dame anzusprechen. Ich räuspere mich kurz und sage mit gedämpfter Stimme: „Entschuldigen Sie bitte.“
Die Angestellte bleibt stehen und wendet sich mir zu. Vor mir steht eine junge, dunkelhäutige Frau mit langen Rastazöpfen, perfekt geschminkt und mit einem akkuraten Lidstrich, für den ich sie beneide. Ihre rehbraunen Augen starren mich erschrocken an. Ich muss sofort an die Augen eben eines solchen Tieres denken, nachts mitten auf der Landstraße im Scheinwerferlicht eines heranrasenden Fahrzeugs. ‚Keine Gnade‘, denke ich mir und rede weiter, denn ich möchte nach einem langen Arbeitstag nur noch nach Haus. „Ich würde gerne ein Kopfkissen kaufen.“
„Ein Kopfkissen?“ Kaum zu fassen, aber ihre Augen werden noch größer.
„Ja, ein Kopfkissen.“ Ich komme mir etwas albern vor, dass ich meinem Wunsch in einem Bettenfachgeschäft noch mal verbal unterstreichen muss, als hätte ich sie nach einem Pümpel gefragt. Wir starren uns gegenseitig an. Das Schweigen zieht sich in die Länge. Nichts passiert. Es hätte nur noch gefehlt, hätte sie mich gefragt: „Und was kann ich dafür?“
Ich beschließe direkter zu werden, denn mit den allgemeinen Anspielungen und Floskeln komme ich hier nicht weiter. „Können Sie mir helfen?“, frage ich und lächele sie zuckersüß an. Vielleicht kann man dem Mädel so die Scheu nehmen.
Tatsächlich löst sie sich aus der Erstarrung und sagt: „Ich glaube, die sind da hinten.“ Sie zeigt mit einem Finger den Gang hinunter. Doch ihre Füße bewegen sich keinen Millimeter. Wahrscheinlich wurde mein Lächeln nun etwas eisig, denn sie lässt resigniert die Schultern sinken und setzt sich in Bewegung. Ich folge ihr.
Hinter der ersten Trennwand bleibt sie freudestrahlend stehen und sagt: „Bitte schön, hier sind Ihre Kopfkissen!“ Vor mir stehen eine Reihe Rollcontainer mir Kisseninletts mit den Maßen vierzig mal vierzig Zentimeter.
Ich bin kurz sprachlos, fange mich aber schnell wieder. „Äh, wissen Sie, wenn ich mein Sofa mit neuen Dekokissen bestücken wollen würde, dann wäre ich hier sicherlich richtig. Aber ich suche ein Kopfkissen. Ich möchte darauf schlafen.“
„Ach, so!“, sagt sie mit einem langgezogenen Unterton, der mir zu verstehen gibt: ‚Warum haben Sie das denn nicht gleich gesagt.‘ Nun gut, vielleicht war ich wirklich etwas vage, ich hätte das mit dem „darauf schlafen“ tatsächlich erwähnen können.
Unser Verständigungsproblem scheint beseitigt, denn die nun überraschenderweise motivierte Verkäuferin eilt zügig drei Reihen voran. Ich folge ihr erneut. Und tatsächlich, hier sind Kopfkissen! Die junge Dame setzt ein breites Gewinnerlächeln auf, so das sogar der kleine Glitzerstein auf ihrem Eckzahn aufblitzt. Ich muss zugeben, ich bin positiv überrascht. Auf zur nächsten Schwierigkeitsstufe! „Jetzt habe ich einen besonderen Wunsch“, setze ich an. Miss Rastalocke, jetzt von ihrem Erfolg, mir das Richtige gezeigt zu haben, beflügelt, schaut mich erwartungsvoll an. „Ich hätte gerne ein halbes Kissen.“
Das strahlende Lächeln wird von echtem Bedauern abgelöst, als sie sagt: „Das tut mir leid. Da kann ich Ihnen nicht weiterhelfen, denn wir verkaufen nur ganze Kissen.“
Ich hole tief Luft, um nicht laut loslachen zu müssen. Dann, als würde ich mich mit einem sehr, sehr jungen Menschen unterhalten, sage ich langsam und betont deutlich: „Es gibt fertige Kissen, die haben eine Größe von achtzig mal vierzig Zentimeter und nicht achtzig mal achtzig. Dazu sagt man auch ‚halbe Kissen‘.“ Ich wedele begleitend mit den Händen in der Luft, um ihr ungefähr die Form zu demonstrieren.
Miss Rasta dreht sich auf dem Absatz um und geht eine Reihe weiter. Ich folge ihr. Darin habe ich mittlerweile Übung. Und endlich, vor mir tut sich eine ganze Reihe Kopfkissen in der Größe von achtzig mal vierzig Zentimeter auf. Wir wirken beide gleichermaßen überrascht, dass sich solche Schätze in diesem Laden auftun können. Es ist für jeden etwas dabei, für den Seitenschläfer, Rückenschläfer, Bauchschläfer, mit Gel-, Schaumstoff oder Daunenfüllung, in einer Preisspanne von fünfzehn bis hundertfünfzig Euro. Wir stehen Schulter an Schulter und lassen unsere Blicke über das umfangreiche Sortiment schweifen.
„So. Ich bin Bauchschläferin“, fange ich wieder an, „habe eine Hausstaubmilbenallergie und der Preis sollte sich im Rahmen halten. Welches Kissen würden sie mir empfehlen?“
Das Mädel zuckt so doll mit den Achseln, dass ihre Zöpfe tanzen, und teilt mir Mitleid erheischend mit: „Ach, wissen Sie, ich bin neu hier.“
„Wirklich?!“ Mein Ausspruch trieft nur so vor Sarkasmus.
Miss Rasta schaut mich mit einem Blick schräg von der Seite an, der mir klar sagen soll: ‚Verarschen kann ich mich allein!‘
Ich hingegen schenke ihr nur ein verschmitztes Grinsen, das sagt: ‚Sorry, aber das konnte ich mir jetzt nicht verkneifen.‘ Was soll ich sagen, Miss Rasta und ich verstehen uns auch ohne Worte. Aber eines muss ich ihr lassen, sie bleibt brav bei mir stehen.
Ich beginne zu referieren, welche Eigenschaften mein Kopfkissen haben muss und warum, wie zum Beispiel, dass man es mit mindestens sechzig Grad waschen können muss und keine Daunen haben darf. Sie nickt, als Zeichen des Verstehens, macht aber keine Anstalten mir suchen zu helfen. Also beginne ich für mich, die einzelnen Schilder über den Produkten durchzugehen. Nach einer kleinen Weile, kommen zwei Kissen in die engere Auswahl. Doch wenn ich nun hoffe, dass die Waren entsprechend unter dem jeweiligen Schild einsortiert wären, dann hatte ich mich zu früh gefreut. In diesem Laden ist so einiges anders und nichts so, wie es sein sollte. Ich wende mich also wieder an die Verkäuferin des Monats, denn die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Vielleicht überrascht sie mich doch noch. „Können Sie mir sagen, wo ich die beiden Kissen finde?“
Kaum, dass ich die Worte ausgesprochen habe, sehe ich auch schon ihren Blick. Ich hätte fast noch hinzugefügt: ‚Nein, ich will Sie nicht verarschen!‘ Aber wir beide verstehen uns mal wieder nonverbal. Ich wende mich somit wieder den Regalen zu und suche allein. Wenigsten waren die Hersteller so schlau und hatten ihre Waren gut leserlich beschriftet. Die wussten wohl warum. Und voila, schon hielt ich meine beiden Kissen in den Händen. Die Verkäuferin zieht die Augenbrauen hoch und schaut mich etwas beeindruckt an. Jetzt kommt nur noch die Drück- und Fühlprobe, dann habe ich es gleich geschafft.
Plötzlich kommt eine Dame, optisch eine klassische Hausfrau aus dem Bilderbuch, Mitte sechzig, auf uns zu. Sie hält etwas in der Hand, das mich irgendwie an eine Mischung aus Flokati und Teewärmer in quietsche grün erinnert. Sie mustert uns beide, aber zum Glück trägt Miss Rasta das blaue Hemd mit der Aufschrift und dem schönen Logo vom Fachgeschäft. Trotzdem sieht sie zwischen uns beiden hin und her. Dann fragt sie das Verkaufsgenie neben mir: „Sagen Sie, sind das die aus dem Prospekt?“
Miss Rasta, die so etwas anscheinend zum allerersten Mal hört, fragt entgeistert zurück: „Welchem Prospekt???“
Ich kann mir gerade noch verkneifen, laut loszulachen. Innerlich schnaubend und breit grinsend wende ich mich an Miss Ich-Bin-Neu-hier und sage: „Vielen Dank, Sie haben mir sehr geholfen!“
Völlig irritiert schaut sie zwischen mir und der Frau mit dem Gebilde wie ein geplatztes Sofakissen hin und her und antwortet allen Ernstes: „Gerne.“
Ich schnappe mein Kissen, eile zur Kasse und bin positiv überrascht, dass der junge Mann sich inzwischen von seiner Lektüre getrennt hat und mich gleich abkassiert.
Zurück auf der Straße denke ich, dass das alles in allem ein netter Einkauf war. Ich habe ein Kopfkissen und fahre erheitert und mit guter Laune nach Haus.
Hinter Gittern
Ein Mann mit einer blauen Tasche auf dem Rücken winkt am Straßenrand. Ich halte mit meinem Taxi. Er steigt ein und wirkt ein wenig verlegen. Er nennt mir die Adresse, und ich fahre los.
Der Unbekannte begutachtet mich von der Seite, unschlüssig, was er von mir halten soll. Ich wundere mich etwas über diesen Argwohn, nehme es aber kommentarlos hin. Ich hatte schon genügend seltsame Menschen im Wagen. Da er nicht bedrohlich auf mich wirkt, lächle ich ihn nur kurz an und mache meinen Job. Und plötzlich erzählt er mir seine Geschichte…
Nun bin ich hier. Und ich weiß, warum. Es war so der beste Weg. Hätte die Staatsanwaltschaft noch mehr herausbekommen, wäre diese winzige Chance, doch nicht für länger einzufahren, nicht existent. Ich musste mich selbst stellen.
Kalkulierbares Risiko nennt man so etwas wohl. Ein bis zwei Jahre im schlimmsten Fall. Aber wenn ich wieder rauskomme, bin ich wenigstens kein armer Mann mehr. Und mit ganz viel Glück, reichen die zwölf Wochen Untersuchungshaft und der Rest wird auf Bewährung ausgesetzt. Vielleicht habe ich Glück.
Ich darf nichts mit reinbringen. Aber da es hier alles zu kaufen gibt, außer Alkohol, ist es nicht weiter schlimm. Ich habe mir dreitausend Euro auf mein Haftkonto eingezahlt. Für zwölf Wochen müsste das reichen. Ich bin Raucher, und zwar starker Raucher.
Meine Zellentür öffnet sich, ein Justizbeamter bringt mir mein erstes Essen. Doch ich habe noch gar nicht so großen Hunger, sondern eher einen Schmachter. Ich frage ihn: „Ich brauche Zigaretten oder Tabak. Wie und wo kriege ich das?“
Der Beamte guckt mich an und runzelt die Stirn. „Sie sind doch gerade erst eingefahren, oder?“
„Ja, erster Tag hier.“
Ein Lächeln huscht über sein Gesicht, doch in der nächsten Sekunde ist nichts mehr davon zu sehen. „Da müssen Sie sich wohl noch etwas gedulden.“
„Wieso? Was soll das heißen?“ Ich verstehe nicht ganz. Oder ich will ihn nicht verstehen.
„Ihnen steht noch kein Geld zur Verfügung“, antwortet er mir ruhig und sachlich.
Ich werde nervös. Er muss sich irren. „Doch, natürlich! Ich habe im Vorweg eine gewisse Summe auf mein Haftkonto eingezahlt.“
Jetzt lächelt er wieder, doch es erreicht seine Augen nicht. Ganz ruhig und gelassen doziert er: „Es tut mir leid, aber der Verwaltungsapparat läuft hier ein bisschen langsamer. In etwa einer Woche bis zehn Tagen wird Ihnen der angewiesene Betrag tatsächlich gutgeschrieben, so dass Sie darüber verfügen können.“ Damit dreht er sich um und verlässt meine Zelle.
Ich stehe da, allein mit meinem Essen. Das metallische Klirren der Schlüssel dringt wie ein Messerstich in mein Bewusstsein. Erst jetzt, nach und nach, kommt das erbarmungslose Verstehen. Ich bin eingesperrt. Allein. Und auf die Hilfe und das Wohlwollen anderer angewiesen. Ich bin mittellos. Außerdem wird mir schmerzlich klar, ich bin Kettenraucher ohne Tabak. Ich bin auf kaltem Entzug. Hiermit beginnt meine tatsächliche Strafe.
Mein dritter Tag hier. Ich habe ein Buch in der Hand, und meine Hände zittern. Eigentlich müsste das Verlangen nach einer Zigarette langsam etwas nachlassen, aber das tut es nicht. Ich versuche mich auf den Text zu konzentrieren. Diese Seite lese ich bereits zum vierten Mal, ohne deren Inhalt aufgenommen zu haben. Ich kann mich nicht konzentrieren. Außerdem habe ich noch nie gerne gelesen. Auf meine Frage, wo denn der Fernseher wäre, welchen ich zu Beginn beantragt hatte, bekam ich nur die Antwort: „Es dauert ungefähr eine Woche, bis die Anträge bearbeitet sind. Erst wenn das durch ist, darf man Ihnen den gewünschten Gegenstand auf die Zelle bringen.“
Eine Woche. Alles dauert hier mindestens eine Woche. Mir ist noch nie so bewusst gewesen, wie lang eine Woche sein kann. Was ist eine Woche? Sieben Tage, mit vierundzwanzig Stunden, mit jeweils sechzig Minuten und diese mit sechzig Sekunden.
Zeit… Man sagte mir vor Haftantritt, das Einzige, was ich von außen mit hineinbringen dürfte wäre eine Uhr. Ich habe aber schon seit Jahren keine mehr getragen, also habe ich darauf verzichtet. Wenn ich wissen wollte, wie spät es ist, habe ich auf mein Handy gesehen. Dieses musste ich beim Einfahren abgeben. Ich hatte gedacht, es würde mich massiv stören, eine längere Zeit ohne Mobiltelefon zu sein. Aber so ist es nicht, denn es gibt etwas, das ist viel schlimmer. Und zwar viel Zeit zu haben, aber kein Zeitgefühl.
Mein Tag besteht aus dreiundzwanzig plus eins. Dreiundzwanzig Stunden Zelle, eine Stunde Freigang im Innenhof. Diese eine Stunde ist gesetzlich vorgeschrieben, die darf mir keiner nehmen, komme was wolle. Eine Stunde raus ins Licht, etwas gehen, auch wenn es nur im Kreis ist. Mir fehlt die Bewegung. In der Zelle kann ich maximal ein paar Liegestütze machen. Und lesen. Und schlafen. Aber ohne Bewegung werde ich nicht müde. Gefühlt schlafe ich am Tag nur wenige Stunden. Das ist dann die schönste Zeit. Vergessen und entspannen. Doch wenn wieder aufwache, dann ist es meistens noch dunkel. Wie lange habe ich geschlafen? Ist es schon morgen? Fängt es gleich an zu dämmern oder ist es noch mitten in der Nacht? Wann öffnet sich die Tür für die nächste Mahlzeit? Das Essen ist widerlich, aber das sind die einzigen Momente am Tag, wo ich mit Sicherheit weiß, wie spät es ist. Zeit… ich habe zu viel davon und kann sie nicht greifen.
Ich denke und bin absolut allein mit meinen Wirrungen. Doch ein Begriff bekommt langsam ein ganz anderes Bild für mich: Bestrafung!
Eine Woche ist vergangen. Ich habe kein Geld und auch keinen Fernseher. Aber ich habe mehr Bücher gelesen, als bisher in meinem gesamten Leben. Es scheint mir manchmal so, als würden die Protagonisten mit mir reden, denn das tut sonst kaum jemand.
Dreiundzwanzig plus eins. In dieser einen Stunde versuche ich mein gesamtes Verlangen nach Geselligkeit zu stillen, doch das funktioniert nicht. Man sollte meinen, dass sich alle Gefangenen sofort aufeinander stürzen, um miteinander zu reden, aber dem ist nicht so. Die meisten bleiben für sich. Viele hängen einfach ihren Gedanken nach und laufen im Kreis.
Plötzlich ist der Schließer an meiner Zellentür. Sie öffnet sich. Ich bin total verwirrt, denn ich bin der festen Überzeugung, dass noch nicht so viel Zeit vergangen ist, es gibt noch kein Essen. Ich lege mein Buch beiseite und stehe von meinem Bett auf. Der Vollzugsbeamte kommt direkt auf mich zu. „Ich habe gute Neuigkeiten für Sie“, sagt er.
Mir schießt sofort durch den Kopf: ‚Irgendetwas ist passiert, ich komme raus!‘
„Wenn Sie mögen, dürfen Sie ab jetzt hier einer Arbeit nachgehen.“
„Ich darf arbeiten?“ Damit habe ich gar nicht gerechnet.
„Ja. Das bedeutet, sie dürfen sich mehrere Stunden am Tag in Ihrem Bereich frei bewegen, um Ihrer Arbeit nachgehen zu können. Ihre Zellentür ist für den Zeitraum offen. Außerdem bekommen Sie so mehr Kontakt zu den anderen Insassen.“
Ich überlege nicht lange und sage: „Das klingt gut. Ich mache es.“
„Gut. Dann unterschreiben Sie bitte dieses Formular. Das ist sozusagen Ihr Arbeitsvertrag. Sie werden für Ihre Tätigkeit mit einhundertachtzig Euro pro Monat entlohnt.“
„Ab wann steht mir das Geld zur Verfügung?“ Ich hoffe, dass es eventuell etwas schneller geht als mit meinem Haftkonto.
„Am Monatsende“, war die ernüchternde Antwort.
Ich zucke nur mit den Achseln, was Anderes bleibt mir nicht übrig. Mir ist klar, ich werde nicht wegen des Geldes arbeiten, aber die Aussicht regelmäßig Kontakt zu anderen und endlich eine Aufgabe zu haben, hätten mich sogar dazu verleiten können, dafür zu zahlen, anstatt Geld zu bekommen.
Ich glaube, das Schlimmste habe ich überstanden. Meine Arbeit ist zwar nicht sonderlich aufregend, aber ich habe eine Aufgabe und bin unter Menschen. Meine Kollegen kennen alle die anfänglichen Probleme, wie es ist ohne Geld, ohne Möglichkeiten, aber mit diversen Bedürfnissen.
„Kein Problem, ich kaufe dir zwei Packungen Tabak. Kannst sie mir wiedergeben, wenn du an deine Kohle rankommst.“
Ich bin so erleichtert. Überschwänglich erwidere ich: „Das ist doch klar! Das wird das erste sein, was ich dann kaufe werde.“
„Du weißt aber schon, nichts ist umsonst, oder?“ Er grinst mich verschmitzt an.
Mir schwant Böses. Vorsichtig frage ich: „Was soll das heißen?“
„Keine Angst. Es wäre nur nett, wenn du noch eine Schachtel für mich drauf packen würdest. Quasi als Zinsen. Du verstehst schon.“
Okay, mit dem Deal kann ich leben. „Geht klar!“
Wenn jemand glaubt, diese ganzen Knast-Sendungen würden nur Mist zeigen, der irrt sich. Es ist eine Tatsache, Zigaretten und Tabak sind die erste Währung. Geld nützt nur bedingt. Und wenn es irgendwann aus der Untersuchungshaft in den Strafvollzug geht, wird das Vermögen stark begrenzt, um eine gewisse Gleichheit unter den Häftlingen herzustellen. Es ist scheißegal, wie viel Geld du vor den Mauern besitzt. Du verdienst einhundertachtzig Euro, wovon du nur siebzig Prozent ausgeben darfst. Die restlichen dreißig Prozent werden von der Anstalt für dich auf einem speziellen Konto angelegt, damit du bei der Entlassung einigermaßen flüssig bist. Die meisten besitzen bei ihrer Entlassung gar nichts mehr. Sollte aber draußen Kapital vorhanden sein, dürfen maximal weitere einhundertfünfzig Euro geschickt werden. Das ist dann das absolute Limit.
Aber es gibt überall Schlupflöcher. Alles was drinnen in der Untersuchungshaft gekauft wird, darf mit in den Strafvollzug genommen werden. Ich stehe in unserem Knastshop. Vor mir ein Mitgefangener, mit dem ich schon häufiger geredet habe. Er sitzt wegen dem Handel mit illegalen Substanzen, die Beamten haben vier Kilogramm Kokain bei im gefunden. Geld spielt bei ihm keine Rolle. Noch! Er hat mehr als drei Jahre bekommen, deswegen fährt er demnächst in „Santa Fu“ ein. Das ist die Justizvollzugsanstalt in Hamburg-Fuhlsbüttel. Dort sitzen die schweren Jungs. Alle unter drei Jahren gehen nach Billwerder.
„Hey, pack nochmal zehn Stangen von denen ein und dann noch zwanzig Packungen Tabak,“ bestellt er großspurig und wedelt dabei mit den Händen, um noch mal deutlich zu machen, was er nun genau kaufen will.
Ich bin verwundert und frage: „Was willst du denn damit? Du rauchst doch gar nicht.“
Er guckt mich an, schmunzelt und antwortet: „Ne, ich nicht, aber viele andere.“
„Und wo lässt du den ganzen Krempel?“ Es war nicht der erste Großeinkauf, den er startete. „Die Zellen in Fuhlsbüttel sind nicht dafür bekannt, dass sie so viel größer sind als die hier.“
Er lacht bei dem Gedanken laut auf und fügt hinzu: „Außerdem würde man mich ständig beklauen. Nein, die Sachen werden dort für mich eingelagert, und bei Bedarf kann ich mir rausgeben lassen.“
Ich bin überrascht, von der Möglichkeit habe ich bisher noch nichts gehört. Aber sonst ist es logisch, Tabak ist hinter Gittern die gängige Währung, er nimmt nur einen Umtausch vor. Und wenn er sich in „Santa Fu“ gut verkaufen kann, dann bestimmt er den Kurs.
Ein Neuer in unserem Block. Er hat seine erste Woche rum und darf ebenfalls arbeiten. Sonderlich glücklich sieht er aber nicht aus. Natürlich sind wir alle Gefangene, aber normalerweise sehen die Neulinge beim ersten Arbeitsantritt erleichtert aus, ihrer Zelle wenigstens für eine Weile entgehen zu können. Und fast alle haben das dringende Bedürfnis zu reden, er nicht. Er hält sich eher etwas abseits und beäugt uns andere extrem misstrauisch.
Neugierig frage ich meinen Kollegen: „Weißt du, warum der sitzt?“
„Keine Ahnung, wegen irgendwelchen kleineren Betrugsdelikte. Er soll nach Billwerder.“
Aha, ein Bruder im Geiste, denke ich. Wir lassen ihn.
Die nächsten zwei Tage kommt er nicht. Dann plötzlich ist er wieder da. Über seinem rechten Auge prangt ein dicker Bluterguss.
Ich ticke meinen Kollegen, der meistens neben mir arbeitet, an und frage: „Was ist denn mit dem passiert?“
„Ich habe gehört, er ist gestürzt“, antwortet er mir mit einem diebischen Grinsen im Gesicht.
Ich glaube ihm kein Wort. „Nein, jetzt mal im Ernst, was ist mit dem passiert?“
„Die Justiz macht so einiges, um manche Leute zu schützen. Zum Beispiel geben Sie einen falschen Haftgrund an, wenn die Leute einfahren. Sie meinen, sie müssten es tun, da ein paar Insassen besonders schützenswert wären. Nein, sagen wir es anders, sie wissen, dass einige mehr Schutz bräuchten, wenn bekannt werden würde, was sie tatsächlich getan haben. Sie manipulieren quasi die Haftpapiere. Nur die Beamten wissen was Sache ist. Doch unter denen gibt es zum Glück mehrere, die einen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit haben. Man kann sich schließlich mal versprechen, oder?“ Er zwinkert mir verschwörerisch zu.
„Aha, ich verstehe“, bin ich jedenfalls der Annahme. „Und was hat er nun gemacht.“
„Unzucht mit Minderjährigen. Er ist ein Kinderschänder.“
Sofort sehe ich den Typen mit anderen Augen und bedauere ein wenig, dass er nicht mehr abbekommen hat als ein Veilchen.
Am nächsten Tag erscheint er wieder nicht zur Arbeit. „Hey, wo ist denn der mit der Vorliebe für kleine Kinder?“
„In Isolationshaft. Ich habe gehört, es ginge ihm nicht so gut.“
Allgemeines Gelächter um uns herum. Ich stimme mit ein.
Die Tage und Wochen vergehen zähflüssig wie Sirup im Winter. Jeden Tag die gleiche Routine. Elf Wochen, siebenundsiebzig Tage, eintausendachthundertachtundvierzig Stunden. Heute kommt mein Anwalt. Ich hoffe, er bringt gute Neuigkeiten.
Endlich werde ich vom Schließer gerufen, ich soll in den Besprechungsraum. Mein Anwalt wartet schon. Als ich eintrete, springt er auf, kommt mir ein paar Schritte entgegen und begrüßt mich mit den Worten: „Ich habe etwas Positives zu berichten. Die Staatsanwaltschaft hat entschieden, einer Freisetzung auf Kaution zuzustimmen. Ich habe den entsprechenden Antrag eingereicht. In einer Woche sind alle Formalitäten durch, dann dürfen Sie vorerst raus.“
Ich kann mein Glück kaum glauben. Dennoch frage ich vorsichtig: „Mit welchen Auflagen?“
„Sie müssen sich jeden Tag bei Ihrer Polizeidienststelle melden, damit die sehen, dass Sie sich nicht dem Verfahren entziehen wollen. Sollten Sie es einmal versäumen, aus welchen Gründen auch immer, wird sofort der Haftbefehl wieder in Kraft gesetzt.“
„Damit kann ich leben, Hauptsache ich komme hier raus.“
„Sie wissen, dass sie aber noch nicht auf der sicheren Seite sind?“ Mein Anwalt sieht mich ernst an. „Es stehen immer noch bis zu zwei Jahre im Raum. Natürlich werde ich alles mir mögliche versuchen, um das Ganze abzuwenden. Aber es ist leider noch nicht vorbei.“
„Ich weiß. Aber ich weiß auch, warum ich hier bin. Dennoch hoffe ich.“
Zwölf Wochen, vierundachtzig Tage, zweitausendsechzehn Stunden. Obwohl die letzte Woche gefühlt länger war, als die elf davor. Nein, falsch, die erste Woche war immer noch am Schlimmsten. Aber das Warten auf die Freiheit, wenn man so kurz davorsteht, ist extrem.
Nun sind die letzten Minuten angebrochen. Mein Anwalt ist unten und zahlt das Geld in die Kautionskasse ein. Ich packe inzwischen die blaue Tasche, mit der ich eingefahren bin.
Plötzlich geht es schnell. Der Schließer holt mich ab, ich werde an andere Justizbeamte weitergereicht und schon stehe ich mit meinem Anwalt draußen vor dem Tor. Ich bin frei! Und fühle mich total überfordert.
Mein Anwalt zeigt die Straße hinunter und sagt: „Hinter der nächsten Ecke links ist ein Taxiposten, sonst ein Stückchen weiter beim Hotel.“
Ich nicke nur.
Er schüttelt mir die Hand und gibt mir noch mit auf dem Weg: „Viel Glück und vergessen Sie nicht, sich bei Ihrer Polizeidienststelle zu melden. Sonst sind Sie heute Abend schon wieder hier.“
„Ja, ich verstehe.“
Natürlich waren beide Taxiposten leer. Jetzt stehe ich hier mit meiner blauen Tasche, bin frei und weiß nicht weiter. Ich muss zur Bank, zur Polizei, in meine Wohnung und dann zu meinen Eltern.
Ich habe zwei kleine Hunde, zwei Malteser, meine Eltern haben sie vorübergehend bei sich aufgenommen. Aber das war nur eine Notlösung. Ich dachte, ich hätte sie damals in gute Hände gegeben. Aber nach ungefähr einer Woche hat sich diese Person bei meinen Eltern gemeldet und pro Monat eintausend Euro verlangt, wenn sie sich weiterhin um die Tiere kümmern soll. Meine Eltern sind hin und haben sie kurzerhand abgeholt. Was ich mit den beiden mache, sollte ich tatsächlich für zwei Jahre einfahren, weiß ich noch nicht genau. Ich möchte sie nicht verlieren. Aber um das Problem kümmere ich mich, wenn es soweit ist. Sie geben einem schließlich circa drei bis vier Monate, um persönliche Dinge vor dem Haftantritt zu regeln.
Oh, da kommt ein Taxi! Vielleicht habe ich Glück und es hält, wenn ich winke.
… die Fahrt ist zu Ende. Es kommt mir ein wenig so vor, als würde ich aus einer anderen Welt auftauchen. Er mustert mich immer noch von der Seite, aber lächelt nun dabei.
Er bezahlt den Fahrpreis und gibt mir ein gutes Trinkgeld.
Ich nehme die Summe entgegen und sage: „Vielen Dank für die nette Fahrt!“
Er sagt: „Nein, ich habe zu danken. Es war so schön, endlich wieder mit einem Menschen zu reden.“
Ich habe nur eine vage Vermutung, welche tiefere Bedeutung tatsächlich hinter diesen Worten steckt.
Beobachtung im Straßenverkehr
Hamburg im Baustellen-Wahnsinn. Wie soll es auch anders sein, und ist genauso fester Bestandteil wie das Amen in der Kirche. So kommt es mehr als einmal am Tag vor, dass man auf eine Fahrbahnsperrung trifft, wo es von zwei auf nur eine Spur geht, und die Verkehrsteilnehmer das Reißverschlussverfahren anwenden sollen. Dumm ist nur, dass kaum noch jemand Reißverschlüsse zu kennen scheint. So bekommt der Spruch „Er hat ein Benehmen wie eine offene Hose“ eine sehr bildliche Bedeutung.
Vor mir fahren eine Mercedes E-Klasse und ein kleiner, schwarzer Smart. Plötzlich kommt die unvermeidliche Baustelle. Der Smart möchte ordentlich einscheren, doch der Mercedes scheint zu glauben, dass es unter seiner Würde sei, auch nur eine Sekunde für diese motorisierte Seifenkiste zu bremsen. Er gibt sogar extra Gas, damit der kleine Wagen nicht von rechts nach links rüber ziehen kann. Es kommt zur Beinahe-Kollision. Was folgt, ist ein riesiges Hupkonzert. Und so bestätigt sich wieder, der Blinker ist eine Sonderausstattung, Hupe haben sie alle serienmäßig.
Anstatt jetzt wie auch immer geartet weiterzufahren, blockiert der Mercedes den Smart und somit auch alle anderen auf dieser Straße, da er der Meinung ist, dieses Problem ausdiskutieren zu müssen. Ich lehne mich in meinem Sitz zurück und beobachte das Schauspiel.
Die rechte Scheibe der Limousine wird elektrisch heruntergelassen. Sofort kann man ihn drinnen pöbeln hören. Nur verstehen tue ich ihn leider nicht. Doch was für den Hitzkopf nicht ersichtlich ist, dafür aber für alle anderen hinter ihm, ist der nette große Aufkleber auf der Heckklappe des Smarts mit der Aufschrift „SELFJUSTICE – We don’t call the cops“. Um dieses Statement zu unterstreichen, baumelt ein kleiner, roter Boxhandschuh innen am Rückspiegel.
Der Kollege im Smart ist sofort auf Sendung. Die Scheibe auf der Fahrerseite geht nun ebenfalls runter. Ein Schwall von Beschimpfungen begleitet von einigen Speicheltropfen folgen. Ich fühle mich umgehend an ein „Werner“ Cartoon von Brösel erinnert. Ich sehe ihn förmlich vor mir, den „Präsi“, den Chef des Motorradclubs mit der extrem kurzen Zündschnur. Es hätte mich auch nicht gewundert, hätte ich gemeint etwas zu hören, das so klingt wie das Zitat „Wenn hier einer Anna nass macht, dann bin ich das!!“. Wer das nicht kennt, solle sich an dieser Stelle einen Bär von einem Mann, auch mit ähnlicher Behaarung, vorstellen, der mit seinem Organ bei entsprechender Betriebstemperatur eine Diesellok übertönen könnte.
Der Fahrer im Mercedes wagt etwas zu erwidern. Es klingt schon wesentlich kleinlauter, aber dennoch denke ich: ‚Junge, du hast echt Arsch in der Hose.‘
Es herrscht kurz Stille. In meiner Phantasie male ich mir aus, wie ein überlanger schwarz behaarter Arm aus dem Smart direkt durch beide Fenster in den Mercedes greift und den Fahrer am Schlafittchen zu sich hinüberzieht. Leider geschieht das nicht. Stattdessen wird der Fahrer im Smart leiser, was irgendwie noch bedrohlicher wirkt als meine drolligen Bilder im Kopf. Die Worte nun sind anscheinend nicht für die Allgemeinheit und schon gar nicht für Zeugen gedacht. Ich frage mich: ‚Na, steigt er jetzt aus?‘
Die Luft knistert. Der Mercedes scheint abzuwägen, wie wertvoll ihm seine Gesundheit und sein Lack ist. Dann geht alles schnell, er schließt das Fenster und gibt Gas.
Der Smart braucht noch zwei Sekunden, um zu begreifen, was geschehen ist. dann fährt er ebenfalls los.
An der nächsten Ampel stehe ich schräg versetzt hinter unserem Freund in dem schwarzen Elefantenrollschuh. Er erfüllt absolut jedes Klischee: Ein Bär von einem Mann, schwarze Haare, Vollbart, schwarze Kleidung. Die Halsschlagader kann man auch ohne Aufregung gut erkennen.
Ich nehme mir fest vorgenommen, sollte ich mich jemals mit jemanden auf der Straße anlege wollen, gucke ich als erstes in das andere Auto.
Blitzermarathon in Hamburg
Fazit eines „Blitzermarathons“ in Hamburg, neben ein paar wenigen herausragenden Persönlichkeiten, wie zum Beispiel mit 180 km/h über die Bergedorfer Str. (erlaubt sind dort zum Teil nur sechzig), zählt die Hamburger Polizei über eintausend Raser… und ja, ich gestehe, ich bin einer davon.
St. Pauli, bekannt für alles, was nicht jugendfrei ist. Wir befinden uns dort in der Seilerstraße. Sie ist eine kleine Seitenstraße, die parallel zur Reeperbahn verläuft. Und wer die nicht kennt, dem ist nicht mehr zu helfen.
Ich starte in meiner Funktion als Taxifahrerin vom „EAST“ Hotel mit einem Fahrgast, der mir sehr schnell verrät, dass er aus Australien käme. Er möchte zum Rathaus, was bekanntlich auf Englisch „Town Hall“ heißt, in seiner Aussprache jedoch eher klingt, wie ein Kampfschrei beim Rodeo. Trotzdem erahne ich, wohin er möchte.
Gleich zu Beginn der Fahrt lässt er sich von meinem fragenden und oft hilflosen Gesichtsausdruck nicht demotivieren und versucht mir eifrig etwas über Hamburg zu entlocken, da er vor seinem Abflug noch drei Stunden Zeit hätte, sich etwas anzusehen. Unterdessen biege ich in die kleine, besagte Straße ab, um dem Verkehr auf der Hauptstraße zu entgehen, und fahre diese schnurgerade hinunter.
Ich hänge meinem Fahrgast an den Lippen, in der stillen Hoffnung, so leichter zu erkennen, was er mir sagen möchte. Da ich weder im Deutschen noch im Englischen Lippenlesen kann, sind meine Bemühungen absolut sinnfrei. Doch die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.
Und plötzlich nehme ich lediglich aus dem Augenwinkel wahr, wie eine kleine Gestalt mit einem weiß-rotem Gegenstand mitten auf die Fahrbahn tritt und winkt. Am liebsten hätte ich gesagt: „Ich bin besetzt, Puppe!“, und wäre einfach weitergefahren. Doch eine innere Stimme sagt mir, dass das keine gute Idee sei. Ich bremse ab und komme vor ihr zum Stehen.
Mit dem Erkennen der Uniform kommt das Begreifen. Den ganzen Tag ging es gut. Ich bin so artig gewesen! Und jetzt gibt es nicht ein teures Foto, wie es sonst so ist, sondern gleich das ganze peinliche Programm inklusive Fahrgast, dem ich nun noch auf Englisch erklären muss, was da und warum das gerade passiert.
„Sie wissen, warum ich Sie angehalten habe?“, fragt die kleine Polizistin mit einem Gesichtsausdruck, der im Prinzip das Gleiche aussagt, wie meiner: Ich habe auf diese Sch… keinen Bock!
Ich hole kurz tief Luft und antworte schlicht und ergreifend: „Ja.“ Im Stillen denke ich: ‚Komm schon, Schätzelein, wir wissen beide, aus dieser Nummer komme ich nicht mehr raus. Gib mir mein Ticket und lass mich weiterfahren.‘
Den Gefallen tut mir die nette Schutzfrau leider nicht. Im Gegenteil. Ungerührt fährt sie fort: „Sie waren ein bisschen zu schnell unterwegs.“
Ich schweige besser und schenke ihr statt irgendwelcher Worte von unten herauf einen Blick, der echtes Schuldbewusstsein ausdrücken soll. Vielleicht hat sie Mitleid und kürzt das Prozedere ein wenig ab.
Doch völlig ungerührt spult sie ihren Text ab. „Sie hatten eine Geschwindigkeit von 41 km/h. Abzüglich der Toleranz von 3 km/h, macht das eine Endgeschwindigkeit von 38 km/h. Hier sind jedoch nur 30 km/h erlaubt. Sie waren acht zu schnell.“
Ich denke: ‚Wow, und das alles ohne Taschenrechner!‘. Und bin so froh, dass ich gerade nicht wie sonst eigentlich, mein Herz auf der Zunge trage. Ich kann mich zum Glück am „Schlüpper“ reißen und halte brav den Mund. Zum Schuldbewusstsein lege ich jetzt noch eine große Portion tiefer Reue drauf. Vielleicht hilft ja das.
Ich bin anscheinend keine so gute Schauspielerin, wie ich gehofft hatte. Mein Blick spricht Bände, in denen aber irgendwie nichts von Schuld und Reue geschrieben steht. Denn unsere Freundin und Helferin schlägt nun einen aufgesetzt ernsten Ton an, als sie sagt: „Wir sind hier nicht zum Spaß! Wir machen diese Kontrolle, weil hier eine Kindertagesstätte ist.“
Ich blicke kurz in den Rückspiegel, und das Einzige, was ich erkennen kann, ist die Leuchtreklame von einem der vielen Sex-Kinos.
Na ja, wenigstens hat die Hüterin von Recht und Ordnung noch den Anstand, nicht zu lachen. Trotzdem werde ich das Gefühl nicht los, dass ihr das Ganze langsam doch Spaß macht. Das Vergnügen ist allerdings ganz auf ihrer Seite.
„Es handelt sich hierbei um eine Ordnungswidrigkeit. Geben Sie Ihr Vergehen zu?“ Erwartungsvoll starrt sie mich an.
‚Wenn ich mich jetzt kurz und knapp halte, dann sage ich nichts Falsches,‘ denke ich und antworte vernünftigerweise: „Ja.“
Damit war das Intermezzo nun noch nicht vorbei. Denn plötzlich wedelte eine leere Hand vor meiner Nase. „Dann geben Sie mir bitte Führerschein und Fahrzeugpapiere.“
Nach einer gefühlten Ewigkeit, mein Fahrgast beteuert mir eifrig, er wäre nicht in Eile (er hatte gerade ein Hamburger Schauspiel gratis und das Taxameter hatte ich gestoppt), kommt Sie zurück und drückt mir alles in die Hand. „Ich wünsche Ihnen noch eine gute Fahrt.“ Mit diesen Worten tritt sie zurück, um erneut hinter mir mit erhobener Kelle auf die Fahrbahn zu springen, denn das nächste Opfer rollt bereits heran. Die armen Kinderchen müssen ja schließlich geschützt werden. Vielleicht freuen sie sich auch über einen Kinobesuch.
So, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, Rathaus, Rodeo und Shopping. Dies ist eine Fahrt für die Hamburger Stadtkasse.
PENG These Bubbles
Immer wieder kommt es vor, dass ich an Diskussionen teilnehmen muss, bei denen ich unter absoluter Verständnislosigkeit leide. Es ist manchmal unfassbar, mit welchen „Problemen“ sich einige Menschen herumschlagen, oder was sie als lebensnotwendig und wichtig erachten.
Eine sehr nette Kundin gab mir mal den Rat, ich solle mir vorstellen, ich sei ein Stuhl. Auf meine Frage: „Warum?“, kam nur die Antwort: „Na, der muss ja auch mit jedem Arsch zurechtkommen.“
Das ist bestimmt ein Weg zur inneren Ruhe, aber ich denke lieber an „These Bubbles“. Was es damit auf sich hat erzähle ich euch nun.
Eine kleine, ältere Dame fährt mit mir zum Flughafen. Sie kommt aus Thailand und hat hier ihre Tochter besucht. Deutsch spricht sie nicht und auch nur gebrochen Englisch, was sie aber auf keinen Fall daran hindert sich mitzuteilen. Und es ist immer wieder erstaunlich, wie gut sich Menschen verständigen können, auch wenn sie nicht die gleiche Sprache sprechen.
Sie ist sechzig Jahre alt, wie sie mir nicht ohne Stolz erzählt, denn sie besitzt die klassische Alterslosigkeit, wie sie viele asiatische Menschen an sich haben. Nur ein paar dezente Lachfalten zeugen von einem humorvollen Leben, dass aber bestimmt nicht immer leicht gewesen sein muss.
Zu Beginn der Fahrt schenkt sie mir eine angebrochene Tube Bodylotion und eine halbvolle Tube Zahncreme. Sie glaubt, beides im Flugzeug nicht mitnehmen zu dürfen, und überreicht es mir, als wäre es eine seltene und kostbare Packung Pralinen. Lächelnd nehme ich es an und bedanke mich höflich.
Während der Fahrt kommen die typischen Fragen, ob ich aus Deutschland komme, wie lange ich schon Taxi fahre und ob ich keine Angst hätte. Dann erzählt sie ganz viel von ihrer Tochter. Sie gerät ins Schwärmen und spricht immer schneller. Bei einer Mischung aus Thailändisch und Englisch verstehe ich dann doch nur noch den Kern der Unterhaltung, jedenfalls bilde ich es mir ein. Ich denke: ‚Okay, nur noch lächeln und nicken, dann machst du nichts verkehrt.‘
Dann wird es still und wir beide hängen unseren Gedanken nach.
Plötzlich schießt ein Arm von hinten nach vorne und wedelt mit einem Stück Luftpolsterfolie vor meiner Nase herum. Mein Herz setzt kurzzeitig aus. Zum Glück stehen wir vor einer roten Ampel.
Zaghaft kommt eine Stimme von der Rückbank und sagt: „I love to PENG these bubbles!! Can I?“
Nach zwei Sekunden, die ich brauche, um mich von meinem Schreck und meiner Verwunderung zu erholen, sage ich nur: „Of course!“
„Thank you!“ Im Rückspiegel sehe ich, wie ein Strahlen über ihr Gesicht huscht.
Die restliche Fahrt über habe ich eine glücklich lächelnde, ältere Dame hinten sitzen und höre nur noch leise: „Peng, peng, peng, peng, peng…“
Wenn wir wieder einmal den Blick fürs Wesentliche verlieren und uns nicht mehr über kleine Dinge freuen können, dann sollte jeder von uns etwas Luftpolsterfolie zur Hand nehmen.
Sport ist Mord
‚Hat sich jemand das Kennzeichen des Lkws gemerkt, der mich überrollt hat?‘ Dies ist mein erster Gedanke des heutigen Tages nach dem Aufwachen.
Was davor geschah…
Nachdem ich es geschafft habe, meinen inneren Schweinehund zu überwinden, habe ich mir einen Termin für ein Probetraining in unserem neuen Fitnesscenter geben lassen. Und als das innere Vieh endlich tot war, bin ich tatsächlich voll motiviert mit meinem knallroten Wanderrucksack (meine Sporttasche hat sich im Laufe der Jahre in Luft aufgelöst oder ist zu Staub zerfallen) hingefahren. Natürlich mit dem Auto, denn Bewegung würde ich gleich genug bekommen.
Dort angekommen, höre ich endlich auf, mit mir zu diskutieren. Es gibt keinen plausiblen Grund, einfach wieder nach Hause zu fahren. Ich bleibe hart und beschließe, nur Beinbruch oder Kopfverlust als Ausrede gelten lassen.
Über dem Eingang des Studios hängt ein großes Schild mit dem Logo der Kette und als Zusatz daneben der Schriftzug „Einfach gut aussehen“. Vorsichtig gucke ich an mir herunter, zucke mit den Schultern und denke: ‚Naja, ich arbeite dran.‘
Kaum, dass sich einen Fuß hineingesetzt habe, werde ich von den Eindrücken erschlagen. Der Laden ist gigantisch!
Erst habe ich vermutet, alle Geräte wären bei dem Andrang von Menschen belegt, aber es sind mehr Plätze frei, als mir lieb ist.
Die Anmeldung erfolgt über einen Computer mit Touchscreen. Von einem Mitarbeiter, der sich auch als Trainer und Mädchen-für-alles herausstellt, bekomme ich meine Clubkarte ausgehändigt. Mit der geht einfach alles, Schrank in der Umkleide öffnen und schließen, Wertsachen wegsperren, Geld aufladen und Getränke kaufen. Meine Karte zum Glück!
Jetzt schnell umziehen und los geht’s!
Immer noch voll motiviert, präsentiere ich mich meinem Trainer/ Mädchen-für-alles, der sich auch gleich entschuldigt, dass er während der Einweisung hin und wieder zum Tresen müsse, da er heute allein ist. Der Kollege sei krank.
Vorsichtig registriere ich die geschätzten einhundert Leute und mustere mein Gegenüber. Anfang zwanzig, Figur eines Hollister Models und eindeutig im Stress. Er erinnert mich an die tragische Gestalt von Sisyphos, dessen Aufgabe nie ein Ende finden wird. Nun gut, nett ist er, nur das zählt im Moment.
Tatsächlich schafft Mr. Hollister es, mir alle Geräte und das gesamte Studio zu zeigen, bevor er mich das erste Mal verlassen muss. Er setzt mich auf ein Ergometer. „Wir beginnen das Training mit fünfzehn Minuten Intervalltraining. Wenn du fertig bist, dann komme bitte zu mir nach vorn.“
Nach der besagten Zeit ist mir schon mehr als warm. Und wenn es nach mir ginge, wäre es für heute genug. Doch mir ist bewusst, so leicht wird es nicht bleiben. Artig schlendere ich zum Tresen und lasse mir Zeit dabei, um mich ein wenig zu akklimatisieren. Doch mein Plan wird sofort durchschaut, denn Mr. Beachbody eilt mir freudestrahlend entgegen und führt mich zum nächsten Gerät auf meinem zukünftigen Trainingsplan.
Zielsicher erkennt er, wieviel Gewicht ich für die einzelnen Übungen brauche. Schließlich soll ich merken, dass ich etwas tue. „Jetzt mache drei Durchgänge mit fünfzehn Wiederholungen.“ Ich nicke artig, obwohl der Schweiß in Strömen läuft und er die Gewichtsermittlung eindeutig nicht als Durchgang zählt.
Das Gewicht auf der Beinpresse ist um einiges zu hoch, so dass ich zwischen der Fußauflage und dem Sitz mit meinem dicken Bauch eingeklemmt werde. Nicht gerade ladylike sitze ich breitbeinig wie ein Frosch auf einem Seerosenblatt und mache ebenfalls so dicke Backen. Mit vereinten Kräften (Meister Propper zieht von hinten) befreien wir mich aus dieser misslichen Lage. Todernst, ohne jegliches Grinsen, korrigiert er das Gewicht und macht mit mir weiter, als ob nichts gewesen wäre. Sehr sympathisch der Mann! Oder einfach nur taktvoll.
Von den vielen Geräten geht es zur „Rückenstraße“, zu den „Ropes“, Sandsäcken, dem Freihantel-Bereich bis zu den Kursräumen. Spätestens hier merke ich, dass ich im einundzwanzigsten Jahrhundert angekommen bin. Sehr schlicht und stylisch gibt es drei verschiedene Räume mit unterschiedlichen Kursen. An jeder Tür befindet sich ein Touchscreen, an dem man erfragen kann, wann welcher Kurs stattfindet. Wer dann in diesen Räumen einen Vorturner oder Animateur erwartet, hat weit gefehlt. Auf einem überdimensionalen Bildschirm läuft ein Film mit einem Trainer, der alles vormacht und man selbst hampelt nach. ‚Willkommen bei Star Trek, hier ist das Holo-Deck!‘, denke ich und beschließe, dass ein Blick von außen zukünftig genügen wird.
Weiter geht es zum Express-Raum. Bei heißen Beats höre ich eine animierte Frauenstimme. „5- 4- 3- 2- 1- Wechseln!“ Runter vom Gerät und zum nächsten. Ich habe dreißig Sekunden Zeit zum Durchatmen, dann wieder eine Minute voll durchpowern. Die Muskeln brennen, und wechseln. Wem eine Stunde trainieren an den einfachen Geräten nicht reicht, schafft es hier in fünfzehn Minuten sich tot zu kriegen. Und ich meine „tot“! Jetzt weiß ich auch, warum das Ding Express-Raum heißt. Per Express ins Sauerstoffzelt oder gleich ins Paradies.
Mr. Fitness muss mich zwar zwischendrin immer wieder verlassen, aber ist stets pünktlich zur Stelle, wenn es weiter gehen soll. Wie schade auch…
Nächste Station ist ein etwas abgedunkelter Raum. „Hier ist das Zirkeltraining für Fortgeschrittene. Ich empfehle dir, hier erst zu trainieren, wenn du schon länger bei uns bist.“ Mir klappt die Kinnlade runter, ich gucke ihn an, schiele zum Express-Raum und weiß sofort, warum der jetzige Bereich etwas dunkler ist. Niemand soll die schmerzverzerrten Gesichter sehen! Gott sei Dank, gehen wir an diesen Geräten nur vorbei, ansonsten müsste man mich wahrscheinlich anschließend notschlachten.
Am Ende habe ich noch etwas Zeit für mich. Ich will mir die Blöße nicht geben und das Studio fluchtartig verlassen. Somit gehe ich nochmal kurz auf die Rudermaschine, hole mir einen Drink und beende dann mein Training.
Jetzt der Morgen danach. Ich habe Muskeln. Mehr als mir lieb sind. Und auch an Stellen, an denen ich sie nie vermutet hätte. Nur die Haare tun nicht weh. Obwohl, wenn ich so darüber nachdenke…
‚Okay, nochmal von vorn! welcher Lkw war es???‘
Wo wir Lebensmittel lieben
Es ist wieder so weit. Ich muss etwas tun, was unumgänglich ist. Wir alle tun es. Und die meisten von uns hassen es. Es ist jedes Mal ein Angehen. Und immer diese quälende Frage, die schon zu so manchen Ehestreit geführt hat: „Was essen wir heute?“ Ich rede vom Einkaufen.
Ungefähr einhundert Meter Luftlinie von unserer Wohnung befindet sich ein Laden, in dem sie Lebensmittel lieben. Bewaffnet mit Einkaufsliste und Portemonnaie mache ich mich auf den Weg.
Unterwegs fällt mir auf, dass ich eine Tasche vergessen habe. Also wird sich heute ein weiterer Beutel zum wachsenden Stapel gesellen. Auf unserem Speiseplan steht Gnocchi-Pfanne mit Hackfleisch. Es hatte ein wenig gedauert, bis wir uns darauf einigen konnten, doch am Ende waren wir beide mit den Kompromissen zufrieden.
Ich betrete den Laden durch die Schiebetüren und sofort umweht mich der charakteristische Geruch, Menschen in verschiedenen Hygienezuständen, Backwaren, Obst und Gemüse, ein industrielles Reinigungsmittel sowie ein Hauch von Verdorbenen. Anhand des Geräuschpegels stelle ich glücklich fest, den richtigen Zeitpunkt abgepasst zu haben, denn es herrscht nur wenig Betrieb.
Ruckzuck sind alle Sachen im Einkaufskorb. Jetzt fehlt nur noch das Hack. Die Fleischtheke ist folgendermaßen sortiert: Rechts Wurstwaren und Aufschnitt, in der Mitte Fleisch und links Käse. Es steht ein Ehepaar vor der Wurst, wobei der Mann nur zur Dekoration und zum Wagenschieben dabei ist, denn zu sagen hat er anscheinend nichts, während seine Frau eifrig bestellt. Ansonsten ist es leer. Ich stelle mich mit meinem Wunsch links neben das Ehepaar, um schon mal die Schilder im Verkaufstresen zu inspizieren. Vielleicht ist etwas im Angebot.
Plötzlich höre ich die Kundin neben mir fragen: „Haben Sie Tiroler Speck?“
„Ja, haben wir“, kommt die Antwort. Die Verkäuferin hebt ein Stück hoch und zeigt es.
„Oh, sehr schön. Wie schneiden Sie den? Dick oder dünn?“
Die Verkäuferin antwortet gelassen: „So, wie Sie es gerne hätten. Möchten Sie es dick, dann schneide ich es dick. Möchten Sie es dünn, dann schneide ich es dünn.“
Ich werde hellhörig und sehe auf.
Die Kundin stützt nachdenklich ihr Kinn mit der rechten Hand ab und fragt: „Was ist denn bei Ihnen dick oder dünn?“
„Naja, dick ist dick, und dünn ist dünn.“
Ich spüre, wie bei mir die Augenbrauen nach oben schnellen. Einen Kommentar oder ein dummes Grinsen kann ich mir gerade noch verkneifen. Ich höre stattdessen gespannt zu.
Die Verkäuferin, der das große Stück Speck langsam zu schwer wird, legt es vor sich auf den Tresen. Dann fragt sie ruhig und professionell: „Was hätten Sie denn lieber? Dick oder dünn?“ Nur ein Lächeln bekommt sie nicht mehr zustande.
„Zeigen Sie mir doch bitte, was dünn ist.“
Die Angestellte hinter dem Tresen nimmt ein großes Fleischermesser und zeigt auf dem vor ihr liegenden Stück Speck an.
Die Kunden macht sich lang und beugt sich ganz weit vor. Eine Reihe von Kisten mit diversen Waren vor der Theke verhindern, dass sie dichter rankommt oder sogar auf den Glastresen klettert. Als sie vermeintlich erfolglos bleibt, greift sie unzufrieden in ihre Handtasche und sagt: „Warten Sie bitte, ich setzte einmal meine Gleitsichtbrille auf, dann sehe ich es besser.“
Das Gesicht der Verkäuferin ist wie eingefroren, sie zuckt mit keiner Miene, wofür ich ihr innerlich Respekt zolle.
Der Ehemann der Kundin steht unverwandt hinter dem Einkaufswagen und starrt hinein. Ob er darin tatsächlich etwas sieht, wage ich zu bezweifeln. Vermutlich ist er mit seinen Gedanken ganz wo anders, da er nicht zum ersten Mal mit seiner Frau einkaufen muss.
Die Verkäuferin rührt sich weiterhin keinen Millimeter und zeigt immer noch die Scheibenstärke an.
Die Kundin, nun mit dem richtigen Durchblick, sagt: „Ja, das sieht gut aus. Ich hätte gerne zwei Scheiben.“
„Sehr gerne.“
Die Mitarbeiterin hat mit der Bestellung gerade erst angefangen, da redet die Frau mit der Brille schon weiter: „Ich hätte danach gerne Käse. Machen Sie das auch?“
„Ja, mache ich. Ich packe Ihnen das hier alles schnell zusammen, dann geht es sofort weiter.“
„Aber da stehen Leute vor.“
Die Verkäuferin fragt: „Wo stehen Leute?“
Kundin: „Na, vor dem Käse.“
Zu dritt blicken wir in Richtung Käse, wo mittlerweile ein junges Paar steht und ebenfalls wartet. Sie inspizieren die verschiedenen Sorten und Preise.
Nun wendet sich die Verkäuferin an die spezielle Kundin und sagt: „Das macht nichts, die kommen nach Ihnen dran. Außerdem bedienen wir von rechts, das war schon immer so.“
Wir Linkssteher, das Pärchen und ich, werfen uns einen irretierten Blick zu und hoffen sehr, dass nicht gleich wieder jemand neues kommt und sich rechts vor die Wurst stellt. Denn wenn sie nicht gestorben sind, stehen sie immer noch vor Fleisch und Käse und warten.
Und da wusste ich wieder, warum ich so gerne einkaufen gehe.